Das Forschungsprogramm für die Abschlussphase
2000 - 2001
Der Sfb 186 befindet sich seit Januar dieses
Jahres in seiner abschließenden Forschungsphase, die mit
dem 31. Dezember 2001 zu Ende geht. 14 Jahre intensiver Forschungsarbeit
werden dann bilanziert und veröffentlicht sein. Hier geht
es zunächst um eine Zwischenbilanz, einen kurzen Rückblick
auf den bisherigen Ertrag und einen Ausblick auf die kommenden
zwei Jahre.
Der deutsche Lebenslauf im Umbruch
In einer pointiert auf das Verhältnis
von Institutionen und individuellen Akteuren bezogenen Forschungsperspektive
ging es in den zurückliegenden Jahren um die gesellschaftliche
Organisation von Lebensverläufen sowie die individuelle
Koordination von Lebensbereichen und biographischen Übergängen.
Institutionen und kulturelle Leitbilder rahmen nicht nur die
Zeithorizonte der Biographie, sondern stellen auch Ressourcen
zur Gestaltung und Reparatur von Lebensverläufen zur Verfügung.
Das Verhältnis zwischen Institutionen und Akteuren ist durch
krisenhafte Modernisierungsprozesse starken Belastungen unterworfen.
Übergänge im Lebensverlauf haben nämlich an institutionell
verbürgter Kontinuität und Ressourcenausstattung sowie
an zeitlicher Konturierung verloren. Damit werden die gesellschaftlichen
Akteure, Institutionen und Individuen gleichermassen unter einen
stärkeren Handlungs- und Legitimationsdruck gestellt, der
sie - wie das Anthony Giddens ausdrückt - zu reflexiver
Regulierung und Steuerung einerseits und zu selbstorganisierten
und selbstverantworteten Lebensläufen andererseits veranlasst.
Diese sich seit dem Ende der Prosperitätsphase
der in der BRD herausbildende Konstellation aktualisiert auch
den Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischen Risiken und
der Kontinuitätsproblematik von Lebensläufen, da sie
neue Muster sozialer Ungleichheit strukturiert. Beispielsweise
dann, wenn Übergangsrisiken bei bestimmten Sozialgruppen
kumulieren und es diesen nicht gelingt, sich mit Ressourcen auszustatten
und Berechtigungsnachweise zu erwerben, die den Kriterien und
Anforderungen der Teilhabe am Beschäftigungssystem und den
Leistungen der sozialen Sicherung entsprechen. So hat die gesellschaftliche
Modernisierung nicht nur die Optionalität für die Gestaltung
von Biographien erweitert, sondern auch die individuelle Abstimmung
zwischen Passagen im Bildungs-, Erwerbs-, Familien- und Ruhestandskontext
sozial ausdifferenziert. Anders ausgedrückt: Der Prozess
der Individualisierung von Biographien ist von sozialer Herkunft,
Bildung, Beruf und Geschlecht nicht unabhängig und an die
Entwicklung von Arbeitsmarkt und Sozialstaat gebunden.
Dennoch wäre es aus soziologischer und
empirischer Sicht voreilig, eine Ursache-Wirkungs-Kette von makrostrukturellem
Wandel (Globalisierung) über institutionelle Reflexivität
zu individualisierter Biographiegestaltung zu konstruieren. Gerade
in der empirischen Lebenslaufforschung wird deutlich, dass zwischen
gesellschaftlichen Makrostrukturen, der institutionellen Steuerung
von Lebensverläufen und den Mikroprozessen biographischen
Handelns - etwa bei der Bewältigung von Übergängen
- lockere Verbindungen, vielfältige Arrangements und Konfliktlinien
bestehen. Dies lässt sich durch Projektergebnisse über
die partiellen oder segmentierten Zuständigkeiten der gesellschaftlichen
Institution für verschiedene Phasen und Konstellationen
im Lebensverlauf belegen.
Die Optionen für Bildung, Erwerb. Zusammenleben,
soziale Sicherung und Gesundheitsversorgung und deren Verfolgung
durch die Individuen werden in der post-traditionalen Gesellschaft
zu einem Feld von Lebenslaufpolitik. Dieses im Sfb 186 entwickelte
Konzept betrifft die institutionalisierte Sicherung, Erweiterung,
aber auch Verengung der Verantwortlichkeit des Individuums -
unter Einbezug seines sozialen Netzwerks - für die Gestaltung
von Übergängen und Statussequenzen und die Überbrückung
von kritischen Lebenslagen oder Statusrisiken. Wenn sich die
sozialstaatlichen Institutionen von einer aktiven und prospektiven
Lebenslaufpolitik zurückziehen, dann hat dies, so zeigen
Projektergebnisse im Sonderforschungsbereich, mindestens einen
zweifachen Effekt: Soziale Ungleichheit vertieft ihre Strukturierungswirkung
auf die horizontale und vertikale Koordination von Übergängen,
und durch die wegfallenden Kontinuitätsgarantien der institutionellen
Lebenslaufpolitik werden die Individuen zunehmend mit einem hohen
Maß an Planungsungewißheit konfrontiert. Mit Blick
auf die gegenwärtige Auseinandersetzung über neo-liberale
und linke Modernisierungspolitik in der Bundesrepublik zeigen
unsere Ergebnisse, dass die deutsche Konfiguration von Lebensverläufen
auch angesichts wachsender Strukturprobleme der sozialstaatlichen
Politik noch durch ein beträchtliches Maß an Stabilität
und Verlässlichkeit über die Lebensphasen hinweg gekennzeichnet
ist.
Den Rückblick zusammenfassend: Das deutsche
Lebenslaufregime, das nach Martin Kohli Kontinuität verspricht,
Übergänge im Lebensverlauf nach Sequenzmustern ordnet
und die individuelle Lebensplanung rahmt, ist zunehmend durch
lebenslaufpolitische Veränderungen geprägt, die das
Verhältnis von Institutionen und individuellen Akteuren
an Schaltstellen der Biographie sowie im Falle von Risikolagen
umgestalten. Diese Konzeption verweist darauf, dass Lebenslauf-
und Biographieforschung im Bremer Sonderforschungsbereich sich
nicht allein auf die Zeitachse der Biographie bezieht, sondern
auch auf die Abstimmung der zum Teil konkurrierenden Partizipationserwartungen
und -verpflichtungen in den Lebensfeldern Bildung, Erwerb, Familie
und sozialstaatliche Institutionen.
Institutionalisierung, Sequenzierung und
Verflechtung: Wege zu einer Theorie des Lebenslaufs
Nun zur Perspektive für die beiden letzten
Forschungsjahre des Sfb.
Die Forschungsziele in der Abschlussphase will ich vor dem Hintergrund
der neuen Kooperationsstruktur der Teilprojekte skizzieren. Dieses
"Rad des Schicksals" - es mag auch mit dem Lebenszyklus
assoziiert werden - ist auf die drei Leitkonzepte "Institutionalisierung",
"Sequenzierung" und "Verflechtung" konzentriert.
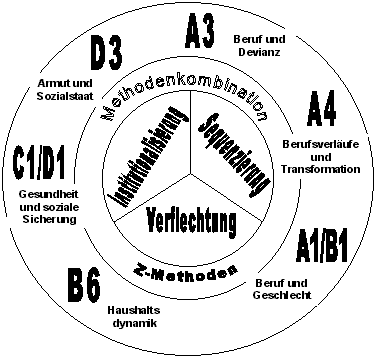
Die seit Beginn des Sfb zentrale Frage der
Wirkung der gesellschaftlichen Formung und Transformation von
Passagen und Übergängen im Lebensverlauf lässt
sich in Bezug auf das Konzept Institutionalisierung auf die vier
folgenden Aspekte beziehen:
1. Wie ist das Verhältnis von Beharrung
und Wandel in den institutionellen Zuständigkeiten für
Lebensphasen?
2. Inwieweit gibt es eine Veränderung
von Steuerung und Administration von Biographien zu einer aktivierenden
Lebenslaufpolitik?
3. Denken deutsche Institutionen ähnlich?
Gibt es explizite oder implizite Abstimmungen zwischen den Leitbildern
der Bildungs-, Beschäftigungs-, sozialen Sicherungs- und
Familiensysteme?
4. Welche Spielräume zum Aushandeln zwischen
Individuum und Institution sind in welchen gesellschaftlichen
Organisationen möglich, und welche Rückwirkungen haben
die Ansprüche auf selbstorganisierte Biographiegestaltung
der Individuen auf das institutionelle Handeln?
Das Leitkonzept "Sequenzierung"
steht im Mittelpunkt der Lebenslaufforschung nicht nur im Bremer
Forschungsansatz. In der Abschlussphase gilt es, das Statuspassagenkonzept
in einen lebenszeitlichen Ansatz zu transformieren, der sich
auf Übergänge und Trajekte, also ganze Verlaufsmuster
bezieht. Von hier aus ergeben sich auch Bezüge zu Theorien
über soziale Mobilität und zu den Alters- und Generationenansätzen
in der Soziologie. Dabei werden die folgenden drei Aspekte hervorgehoben:
1. Die zeitdynamische Analyse von Entry- und
Exitprozessen, deren begriffliche Zusammenschau zu Abfolgemustern
von Übergängen noch aussteht.
2. Die Rolle von Institutionen bei der Rahmung bzw. Steuerung
verschiedener Sequenztypen wie "Brücke" oder "Bruch".
3. Die konzeptuelle und methodische Einbindung der vorrangigen
Analysemethoden von Längsschnittdaten, nämlich event
history analysis und Sequenzmusteranalysen.
Schließlich geht es beim dritten Leitkonzept
"Verflechtung" um die Frage, wie Institutionen Relationen
zwischen Lebensläufen, mit Akzentuierung auf das Geschlechterverhältnis,
herstellen. Folgende Aspekte stehen bei der Ausgestaltung des
Verflechtungskonzepts im Mittelpunkt:
1. In welcher Art kreuzen sich in Lebensgemeinschaften
(Partnerschaften, Familien, Generationen) gesellschaftlich unterschiedlich
strukturierte Geschlechterbiographien? Welche Besonderheit weist
das deutsche Lebenslaufregime bei sozialisatorischen und institutionellen
Weichenstellungen von Lebensläufen nach dem Kriterium Geschlecht
auf?
2. Wie wird über die Familie Lebenslaufpolitik betrieben,
wie reproduzieren sich in diesem Verbundsystem geschlechtsdifferenzierende
Beziehungsmuster, und in welchem Maße kann durch eigenständiges
Beziehungsmanagement die Biographie gestaltet werden?
3. Lassen sich Ergebnisse und Schlussfolgerungen über Verflechtungsmechanismen
gewinnen, die die Individualisierungsthese unterstützen,
relativieren oder gar in Frage stellen?
4. Schließlich wird der Ertrag der Kombinationen quantitativer
und qualitativer Datensätze über verflochtene Lebensläufe
forschungsmethodisch und ergebnisorientiert dokumentiert.
Die drei skizzierten Konzepte dienen der Systematisierung
der empirischen Ergebnisse der Teilprojekte sowie der theoretischen
Interpretation der quantitativen und qualitativen, auf bestimmte
Übergänge und Risikolagen bezogenen Längsschnittstudien
und werden in einer Reihe von teilprojektübergreifenden,
aber auch projektspezifischen Publikationen ausgefüllt.
Das Arbeitsprogramm 2000 - 2001
Die übergreifenden Aufgabenstellungen
für die nächsten beiden Jahre beziehen sich auf die
Zusammenführung der Teilprojektergebnisse zu einem Bild
der Entwicklung und Struktur des deutschen Lebenslaufmodells.
Dieses Ziel wird durch Hinzuziehung kontrastierender, auf andere
Gesellschaften und historische Perioden bezogenen Analysen in
den Teilprojekten A3 und D3 und durch die Auswertung von internationalen
Datensätzen durch B6 vorrangig verfolgt. Dazu kommen die
schon über mehrere Forschungsphasen angelegten Vergleiche
von Berufs- und Familienpassagen in verschiedenen Regionen in
West- und Ostdeutschland. Die Analyse der spezifischen Merkmale
und Organisationsprinzipien des deutschen Lebenslaufs sowie die
Dimensionen und Folgen des Wandels institutioneller Steuerungspraxis
wird auch auf die Debatte um kulturelle Individualisierung und
sozialstrukturelle Ungleichheit im Lebensverlauf bezogen.
Konsequent verfolgen auch die Arbeiten zur
Methodenintegration Verbindungsmöglichkeiten zwischen Erhebung
und Analyse subjektiver Orientierungen und biographische Deutungsmuster
einerseits und von Ereignisverläufen und Übergangssequenzen
im Lebensverlauf andererseits. Der geplante Band zur Methodenintegration
greift auch die Erfahrungen des Sfb bei der Entwicklung der Archivierung
quantitativer und qualitativer Längsschnittdaten auf, die
den Kriterien des Datenschutzes genügen.
Die vielfältigen Ergebnisse des Sfb und
weiterführende Fragen, die sich daraus ergeben, sollen in
einem internationalen Abschluss-Symposium (dem 5. In der Reihe
der Sfb-Symposien) vorgestellt und diskutiert werden. Das Symposium
findet vom 26. bis 28. September 2001 an der Universität
Bremen statt und trägt den Titel "The Life Course:
Institutions, Sequences and Interrelations". |